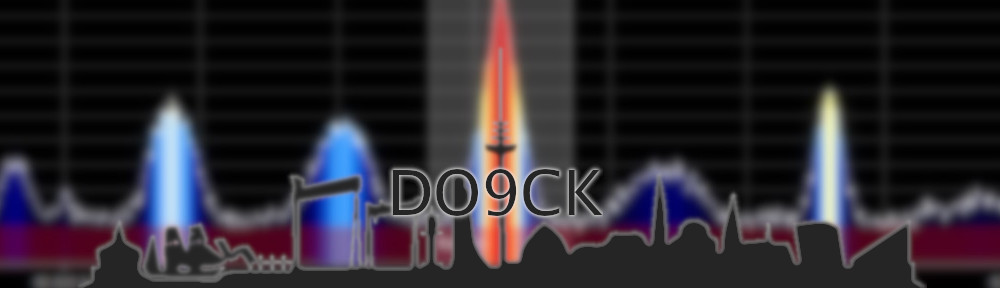Als Betreiber von Reflektoren und Nutzer eines Netzwerk von Relais, bei dem der Betreiber jemandem mit Ausschluss drohte, möchte ich hier einmal die rechtliche Lage zur Frage „Darf ich Funkamateure von der Nutzung meines Relais ausschließen?“ beleuchten.
Technische Realisierbarkeit
Doch bevor es um den rechtlichen Aspekt geht, ein paar Worte zur technischen Realisierbarkeit. Es liegt auf der Hand, dass analoge Relais für FM oder auch Echolink realistische keine Möglichkeit bieten, Funkamateure auszuschließen. Es wird kein Identifizierungssignal geliefert und entsprechend kann das Relais nicht unterscheiden, wer autorisiert und wer ausgesperrt ist. Einziger Hebel ist der Rechtsweg; ein technischer Ausschluss ist unmöglich.
Auch bei digitalen Betriebsarten gestaltet sich ein technischer Ausschluss schwierig. Wird ein Funkamateur anhand beispielsweise einer DMR-ID ausgesperrt, kann dieser einfach mit einer anderen DMR-ID am Netzwerk teilnehmen. Hier gibt es zwar auch Krücken, um die Verwendung der „eigenen“ DMR-ID durch Fremde zu unterbinden, etwa durch TOTP im Brandmeister-Netz, doch auch diese sind weder verbreitet noch praktikabel. Warum „eigene“ in Anführungszeichen? Ganz einfach: Es gibt keine rechtlich zugewiesenen DMR-IDs. Die BNetzA vergibt in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln der ITU Rufzeichen wie beispielsweise DO9CK. Eine Autorität für DMR-IDs existiert nicht. Man hat sich per Konvention geeinigt, eine US-amerikanische Firma hinter radioid.net eine Datenbank pflegen zu lassen und diese zu verwenden, aber es spricht rechtlich nichts dagegen, sich eine beliebige DMR-ID auszudenken oder eine bestehende zu verwenden. Pflicht ist einzig die Rufzeichennennung, die entgegen Hörensagen bei DMR auch nicht durch die übermittelte DMR-ID entfällt. Denn sie hat, wie gesagt, keine rechtliche Bindung.
Kurzum: Ein technischer Ausschluss ist meist nicht praktikabel. Hier kann lediglich der Hebel des Rechtswegs angesetzt werden, indem beispielsweise die BNetzA dem Funkamateur die Auflage macht, das Relais nicht mehr zu benutzen.
Pflichten eines Relais-Betreibers
Die BNetzA vergibt an sogenannte „fernbediente oder automatisch arbeitende Amateurfunkstellen“ besondere Rufzeichen nach § 3 Abs. 3 Nr. 3 AFuG. Hierfür müssen folgende Zwänge eingehalten werden:
- Das Relais arbeitet ortsfest am eingetragenen und genehmigten Standort und unter den genehmigten Rahmenbedinungen und Auflagen (§ 13 Abs. 1 und 3 AFuV).
- Die Verträglichkeit des Betriebs wurde nachgewiesen (§ 13 Abs. 1 AFuV).
- Der Betrieb darf nicht mehr als ein Jahr ausgesetzt oder verzögert werden (§ 13 Abs. 5 Nr. 1 AFuV).
Und jetzt wird es für das Thema spannend:
- Jedem Funkamateur ist die Verwendung des Relais zu gestatten. Ein Ausschluss darf nur dann erfolgen, wenn nur so der störungsfreie Betrieb sichergestellt werden kann. Die BNetzA ist hiervon dann zu unterrichten (§ 13 Abs. 4 AFuV).
Hürden eines Ausschlusses
Der letzte Punkt ist also einschlägig. Schauen wir und diesen einmal im Detail an:
Jedem Funkamateur ist die Nutzung zu gestatten. Das heißt, dass grundsätzlich jeder Funkamateur, also jeder Amateurfunker mit gültiger Amateurfunk-Rufzeichenzuteilung, das Relais nutzen können muss. Eine geschlossene Gesellschaft, in der ein Funkamateur gar nicht oder unter unzumutbaren Hürden aufgenommen wird, ist also nicht gestattet. Jeder, der teilnehmen möchte, darf dies tun. Und falls eine Registrierung aufgrund technischer Gegebenheiten erforderlich ist, ist diese niedrigschwellig zu gestalten und anstandslos durchzuführen. Hierbei ist übrigens auch die Datensparsamkeit zu beachten; der Teilnehmer darf beispielsweise aufgefordert werden, personengebundene Daten anzugeben.
Lediglich dann, wenn der störungsfreie Betrieb nicht sichergestellt werden kann, darf ein Ausschluss erfolgen. Doch was ist störungsfreier Betrieb? Störungsfrei ist der Betrieb, wenn er technisch keine Störungen verursacht, die über den Rahmen des Amateurfunks hinausgehen. Wenn also jemand auf dem Relais einfach die „falsche“ Meinung vertritt oder anderen mit seinen Themen auf die Nerven geht, ist das keine Störung. Die Meinungsfreiheit gilt unbeschränkt und bei strafrechtlich relevanten Äußerungen ist nicht die Relaissperre das Mittel der Wahl, sondern eine Strafverfolgung. Inhaltlich sind dem Betrieb quasi keine Grenzen gesetzt. Und auch technisch sind die Grenzen weit gesteckt. Der Amateurfunk ist explizit „zu experimentellen und technisch-wissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung“ konzessioniert (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 AFuG). Es liegt also im Wesen, dass Experimente durchgeführt und Dinge ausprobiert werden. Diese mögen als Störung empfunden werden, da sie ggf. einer Sprachverständigung entgegenstehen, doch im Sinne des Gesetzes sind sie elementarer Bestandteil des Amateurfunks und eben keine Störung. Eine Störung läge dann vor, wenn durch einen Nutzer das Relais derartig beeinträchtigt ist, dass es etwa unerwünschte Nebenaussendungen erzeugt, von den Rahmenbedingungen und Auflagen der Rufzeichenzuteilung abweichen lässt oder einen Defekt erfährt. Nur dann liegt eine Störung vor und nur dann kann ein Ausschluss erwogen werden.
Neben den sehr hohen Hürden, die sich auf die Inhalte der Aussendungen quasi gar nicht erstrecken dürfen und auch technisch selten erfüllt werden, muss zuletzt über jeden Ausschluss auch die BNetzA informiert werden. Einen Funkamateur einfach auszuschließen oder gar nicht erst teilnehmen zu lassen, ist nicht gestattet. Der BNetzA obliegt es dann, die Rechtmäßigkeit des Ausschlusses prüfen zu können und ggf. wahlweise gegen den Ausgeschlossenen durchzusetzen oder eben aufzuheben. Bei Nichtbefolgung könnte dann die Rufzeichenzuteilung, sei es für den Funkamateur oder sei es für die Relais-Station, widerrufen werden.
Reflektoren und Netzwerke
Bei Reflektoren und Netzwerken kann die Rechtslage etwas anders aussehen. Solche Dienste können, sofern sie klein genug sind, vom umgangssprachlichen „virtuellen Hausrecht“ erfasst werden, bei dem der Betreiber entscheiden kann, wen er zulässt und ob er jemanden ausschließt. Beispielsweise zählt hierzu ein privater Reflektor für einen kleinen Personenkreis, der sich mit Hotspots auf diesen verbindet.
Wird jedoch der Nutzerkreis ausreichend groß, sodass eine gewisse gesellschaftliche Relevanz angenommen wird, ist das „virtuelle Hausrecht“ wieder begrenzt. Beispielsweise ist auch dem Eigentümer von X, ehemals Twitter, nicht gestattet, aus Gutdünken Personen auszuschließen. Auch darf ein solches System nicht explizit an Relais betrieben werden. Ein XLX-Reflektor auf einem C4FM- oder D-Star-Relais etwa könnte in die Grauzone fallen, da die Relais den Wechsel auf einen anderen XLX-Reflektor zulassen. Bei DMR-Relais ist hingegen eine Bindung an ein DMR-Netz gegeben, sodass entweder das DMR-Netz keinen Funkamateur ausschließen darf oder aber die Relais dieses Netzwerk nicht verwenden dürfen.
TL;DR
Jeder Funkamateur darf grundsätzlich auf jedem Relais Betrieb machen. Der Relaisbetreiber muss jedem Funkamateur eine niedrigschwellige und anstandslose Registrierung ermöglichen, sofern technisch notwendig. Er darf nicht aufgrund von legalen Meinungsäußerungen, der Themenwahl, der Nutzungszeiten oder ähnlicher Kriterien ausgeschlossen werden. Er darf ebenfalls nicht aufgrund von Experimenten, Tests und Versuchen ausgeschlossen werden. Einzig, wenn er den gesetzlich geregelten Betrieb des Relais gefährdet, darf er ausgeschlossen werden. Und auch dies nur unter Benachrichtigung der BNetzA. Reflektoren oder Netzwerke, die Funkamateure ausschließen, dürfen nicht explizit auf Relais verwendet werden.