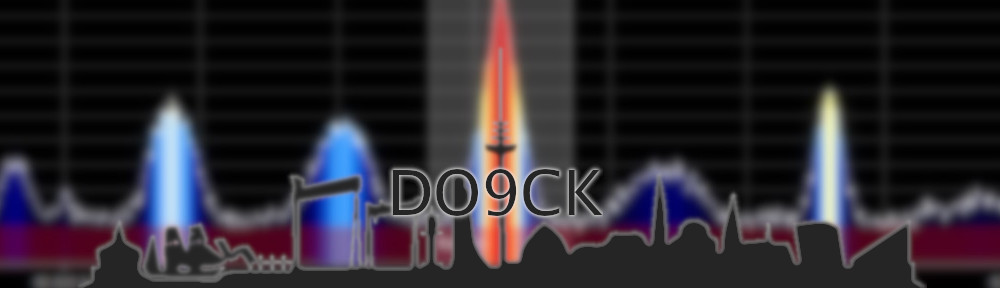Ich habe kürzlich zwei neue SDRs erstanden: Den Airspy Mini und den SDRplay RSP1B. Hier meine ersten Eindrücke zum Airspy Mini.
Zunächst war ich echt skeptisch. Nachdem ich bereits einen Nooelec NESDR SMArt v5 mein Eigen nenne, zog ich zunächst den meiner Meinung nach naheliegenden Vergleich: Beides sind kleine USB-Sticks, kommen im Metallgehäuse daher, haben einen ähnlichen Formfaktor. Nur die Preisklasse ist eine andere. Die Herausforderung war also, den Mehrwert zu erkennen.
Nun habe ich beim Auspacken des Nooelec NESDR SMArt v5 einen sauber verarbeiteten USB-Stick mit Schutzkappen auf USB-Stecker und SMA-Antennenbuchse vorgefunden, während er Airspy Mini spärlich verpackt, mit leicht schief sitzendem USB-Stecker und fehlenden Schutzkappen daherkam. Auch wurde der Airspy Mini im Betrieb schnell heiß, noch etwas schneller als der Nooelec NESDR SMArt v5. Die äußeren Werte überzeugten jetzt nicht direkt. Es ist wirklich nicht so, dass der Airspy Mini sich billig präsentierte, doch der deutlich günstigere Nooelec NESDR SMArt v5 kam hochwertiger daher.
Es muss also auf die inneren Werte ankommen. Hier wartete zunächst eine Enttäuschung auf mich: Während der Airspy Mini mit “10, 6 and 3 MSPS IQ output” wirbt, beherrscht dieser jedoch tatsächlich nur die Bandbreiten von 6 und 3 MSPS. Und diese sind obendrein Brutto-Raten, sodass in der Software Airspy SDR# lediglich max. 4,8 MSPS nutzbare Bandbreite verwendbar sind. Von angenommenen 10 MSPS blieben also 4,8 MSPS übrig. Wenn man den nicht gänzlich ungefährlichen “Debug-Modus” aktiviert, lassen sich 10 MSPS brutto auswählen, was in 8 MSPS netto resultiert. Den Nooelec NESDR SMArt v5 kann man problemlos mit ca. 3 MSPS nutzbarer Bandbreite verwenden. Der Airspy Mini hat hier also leicht die Nase vorn, jedoch rechtfertigt dies m.M.n. nicht den 3,5-fachen Preis.
Doch als ich einmal für den Direktvergleich beide SDR-Sticks mit baugleicher (schlechter) Antenne in einem USB-Hub nebeneinander betrieb, konnte ich einen Unterschied in der Empfangsqualität ausmachen. Hierfür habe mit 2,4 MSPS eine gleiche Bandbreite und keine “Dezimierung” verwendet sowie den Grundpegel auf dasselbe Niveau geregelt. Zunächst habe ich das TETRA-Signal von DM0KIL quasi als Barken-Signal verwendet und auf beiden Sticks verglichen. Hier hat der Airspy Mini mit ca. 28 dB eine merkbar größere SNR als der Nooelec NESDR SMArt v5 mit ca. 18 dB. Auch ist während der Messung ein relativ schwaches Signal auf dem Band eingetroffen, welches beim Airspy Mini klar auf dem Wasserfalldiagramm sichtbar war, während der Nooelec NESDR SMArt v5 dies gar nicht aufnahm. Die Empfangsqualität des Airspy Mini schlägt also die des Nooelec NESDR SMArt v5 gerade bei schwachen Signalen merkbar. Auch sind Spielereien wie schaltbare Filter oder die “Dezimierung” hilfreich, um das Band zu bereinigen. Zudem hat der Airspy Mini etwas weniger Rauschen und Phantomsignale. Die Empfangsqualität des Airspy Mini schlägt die des Nooelec NESDR SMArt v5 also durchaus. Doch auch hier steht die Frage im Raum, ob dies den 3,5-fachen Preis rechtfertigt.
Fazit: Der Airspy Mini ist technisch dem Nooelec NESDR SMArt v5 durchaus überlegen. Doch da er mit dem 3,5-fachen Preis auch einiges mehr kostet, sollte man sich schon überlegen, ob ein Nooelec NESDR SMArt v5 nicht für die angedachten Zwecke ausreicht. Ich persönlich denke, dass der Preisunterschied nicht unbedingt die Leistungssteigerung rechtfertigt. Zudem existiert rund um den Nooelec NESDR SMArt v5 ein breites Spektrum an Software und Hilfe aus der Community. Dies fängt bereits bei einem auf quasi jedem Linux via Paketmanager verfügbaren TCP-Server (rtl_tcp) an, was gerade für mich wichtig ist, der ich die SDRs an einem anderen Standort als meine üblichen Rechner verwende und zudem ein WebSDR betreibe und Zugang von verschiedenen Clients, auch unterwegs, erhalte.
Sobald ich mich in den SDRplay RSP1B reingefummelt habe, der u.a. mit einer anderen Software, der SDRuno daherkommt und nicht mit Airplay SDR# kompatibel zu sein scheint (früher waren SDRplays kompatibel mit Airspy SDR#, doch dies wurde anscheinend unterbunden), schreibe ich auch ein paar Zeilen zu diesem SDR.